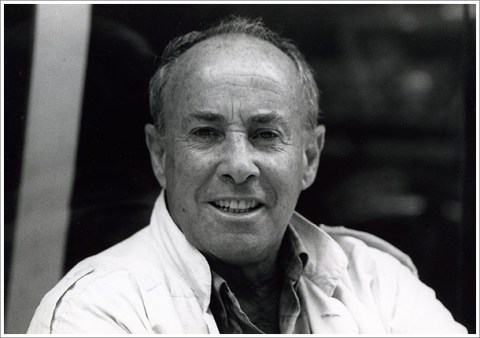1963 als Hauptschüler mit fünfzehn in die Mechanikerlehre in Wilhelmshaven. Ich habe noch den Ölgestank der düsteren Fabrikhallen in der Nase, die entwürdigende Anmache der Ausbilder in den Ohren: „Du Kloake!“
Sinnlose Löcher bohren, sinnlose Bleche feilen, sinnlose Gewinde schneiden, sinnlose Flächen fräsen. Für die Ausgelernten Brötchen kaufen. Hinter ihnen her putzen. Die Gänge fegen. Vom Feilen große Blasen an den Händen, von Metallspänen aufgerissene Finger, Pickel ohne Ende, der wachsende Körper gefesselt, eingezwängt, zerdrückt. In Nyltest-Hemden und Trevira-Hosen ungelenkes Geschiebe in der Tanzschule. „Bist du oft hier?“, sehnsüchtig verklemmte Annäherungen an die Mädchen. Und Eltern, die die alles schönreden. Abends höre ich das Nachtprogramm von Radio Bremen, seltsam schräge Klänge von Boris Blacher oder Anton Webern. Was später „Neue Musik“ hieß und als elitär galt, kündete mir hoffnungsvoll von einem ferneren Leben.
Von meiner ehrgeizigen Mutter in die Abendschule getrieben, um was Besseres zu werden: „Damit Du mal Ingenieur werden kannst“. Der pöbelnde Meister fand das nicht so gut, „Du kannst dich nicht genug auf die Arbeit konzentrieren“, aber ich hatte nach einem Jahr schon gelernt, wenn denen etwas nicht gut tut, tut es mir sehr gut! Um 22 Uhr nach der Schule, meine Eltern schliefen und mir tat sich eine neue Welt auf. In der anrüchigen Bar „Esprita“, Onkel Rudi, der Polizist raunte „da verkehren die 175er“, oder im geheimnisvollen „Moulin Rouge“, einer Kneipe französischer Provenienz, traf ich Gammler, Schwule, Künstler, Leute vom nahen Stadttheater, die anders waren als alle die ich kannte, die anders dachten, anders sprachen, anderes lasen. Ich spürte, es gibt dieses andere, dieses wirkliche, dieses wilde Leben jenseits von Fabrik und Familie.
Nach einem halben Jahr hatte ich einen Parka, in die Stirn gekämmte Haare, immer ein Buch bei mir und konnte in der „Esprita“ anschreiben lassen: Ich gehörte dazu und hatte ein paar fremde Freunde. Weiterlesen