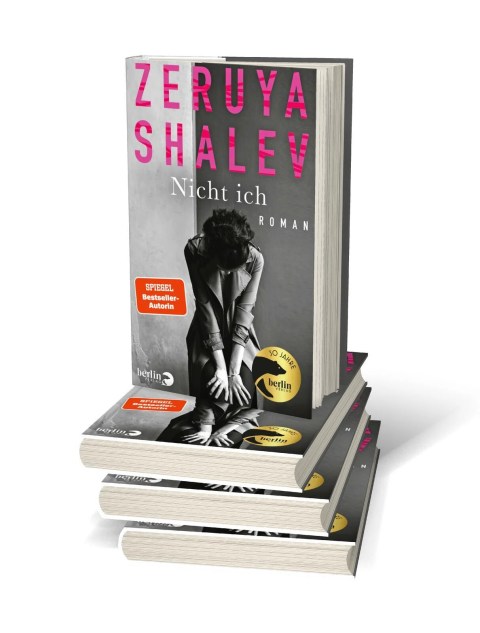Hommage für Detlef Heinichen
Seit sieben Jahren prägt der charismatische Kulturpreisträger, Macher des Theatriums und Bühnenkünstler Detlef Heinichen das kulturelle Leben weit über den Bergwinkel hinaus. Heute – am 12. April – begeht er den 70. Geburtstag, alleine auf dem Pilgerweg zwischen Porto (Portugal) und Santiago de Compostela (Spanien).
„Dieser ‚Camino de Portugues‘ muss was Magisches haben“, sagt er, aber ihn leiten keine religiösen Gefühle, er nutzt die Wanderung zum Nachdenken. Heinichen ist kein Kauz, auch wenn er viele Solostücke mit seinem Figurentheater entwickelte. Er arbeitet gerne mit anderen Akteuren, das haben seine Werke über „Jonny Cash“ oder „Manche mögen‘s heiß“ offenbart.
Seit er in der zweiten Klasse gekleisterte Papierfiguren zum Leben erweckte, fasziniert ihn das Puppenspiel. In seinem ersten Kinderstück staunte er, wie – unerwartet von ihm – die Kleinen reagierten. Seitdem entwickelte er Figurentheater als Hobby, doch in der Pubertät wurde es brenzlig, als er seine Werke im Hinterhof in Magdeburg aufführte. „Spätestens dann verabschiedet man sich ja von Puppen“, erinnert er sich, „aber für mich waren sie keine Kuschelpuppen, sondern Darsteller!“ Er hatte sogar einen „Bodyguard, zwei Jahre älter, zwei Köpfe größer als ich, der mein Spiel mochte und mich vor den Gleichaltrigen schützte.“
Mutig und naiv bewarb er sich mit 17 Jahren an der Schauspielschule, aber man empfahl ihm „noch zu reifen.“ Überraschend ermöglichte ihm der Chef der Zwickauer Puppenbühne eine theaterpraktische Ausbildung. Nach der Militärzeit studierte er ab 1975 an der renommierten Ernst-Busch-Schule in Berlin. Hier reifte er in dreieinhalb Jahren vom Puppenspieler zum umfassend ausgebildeten Schauspieler und kehrte nach Zwickau zurück: „Die gewährt mir eine Chance, ich wollte ihnen was zurückgeben.“
Doch dort wurde es dramatisch, denn 1980 wollte die Stasi – wohl angesichts der revolutionären Ereignisse in Polen – ein Exempel statuieren: Wegen „staatsfeindlicher Äußerungen und Verunglimpfung staatlicher Organe“ auf der Bühne, musste er ein Jahr „in die Produktion“ – in eine Brauerei und ein Ausbesserungswerk: „Das fand ich gar nicht so schlecht.“ Dann kam er nach Dresden, war hier kurz in Stasi-Haft und sah in der DDR keine Chance mehr für sich. 1986 stellte er den schnell bewilligten Ausreiseantrag.
In Bremen übernahm er ein antiquiertes Puppentheater und erneuerte es zu einem zeitgemäßen, gut besuchten Theatrium mit eigenem Festival. Heinichen war gut vernetzt in der avantgardistischen Szene der Stadt, von Peter Zadek bis Johan Kresnik.
Weiterlesen