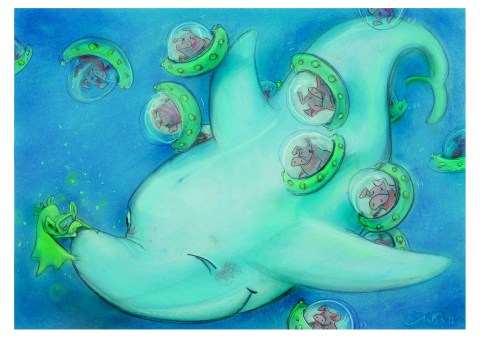Der Goldene Bär für den Film „Es gibt kein Böses“, der als letzter im Wettbewerb gezeigt wurde, war aufgrund seiner cineastischen Qualität keine Überraschung. Ansonsten gingen – wie immer – ein paar Silberbären an Filmschaffende, die zuvor im „Bärenorakel“ der Profi-Kritiker mächtig gefeiert wurden, andere Entscheidungen waren dagegen umstritten.
In der Pressekonferenz zum Festivalbeginn erzählten alle Mitglieder der Internationalen Jury von beeindruckenden Filmerlebnissen in Kindheit und Jugend. Sie sprachen über „Bambi“, „E.T.“ oder Charlie Chaplin und waren sich einig, Filme sollten „von Herzen mit Leidenschaft“ gemacht werden. An diesen Ansprüchen können sich ihre Entscheidungen messen lassen.
Für den Gewinner des Hauptpreises, den iranischen Regisseur Mohammed Rasoulof, gelten diese Jury-Wünsche allemal. Er bekam keine Ausreisegenehmigung und durfte, wie bereits andere iranische Regisseure vor ihm, nicht am Festival teilnehmen. Allerdings erhielt der Streifen den Goldenen Bären nicht als politische Demonstration. Sein Film ist wahrlich „von Herzen mit Leidenschaft“ erarbeitet, sowie gemessen an anderen Beiträgen des Wettbewerbs ein cineastisches und thematisches Meisterwerk.
In vier Episoden zeigt „Es gibt kein Böses“ wie Menschen schuldig werden und damit umgehen müssen. Vordergründig geht es um die Todesstrafe „überall in der Welt“, betonte einer der Produzenten. Aber wie bei vielen iranischen Kunstschaffenden ist diese Verallgemeinerung ein Kniff, um noch stärkeren Drangsalierungen im Land zu entgehen: Kritik an Maßnahmen der Mullahs wird nicht direkt geäußert, sondern weltweit angeprangert.
Sicherlich sind die mit Silberbären ausgezeichneten Darsteller im Vergleich die besten Akteure. Oft stehen sie aber auch, gleichsam als „pars pro toto“, für großartige Werke. So der italienische Schauspieler Elio Germano für die spannend und einfühlsam erzählte Lebensgeschichte des Outsider-Künstlers Ligabue („Hidden Away“). Oder die, derzeit mächtig durchstartende Paula Beer als magische Undine in einer entzauberten Welt im gleichnamigen deutschen Beitrag „Undine“. Beide Werke sind „von Herzen und mit Leidenschaft“ gemacht – und wie viele andere im und außerhalb des Wettbewerbs dennoch politisch, wenn man das Politische so erweitert, wie die Berlinale. Häufig aufgegriffene Themen wie Abtreibung, Gender oder Migration waren und sind ja allemal politisch. Doch der künstlerische Leiter Carlo Chatrian fasste das Politische noch weiter: „„Für mich ist Kino dann politisch, wenn ein Film sein Publikum dazu auffordert, die eigene Sichtweise zu ändern.“ Weiterlesen